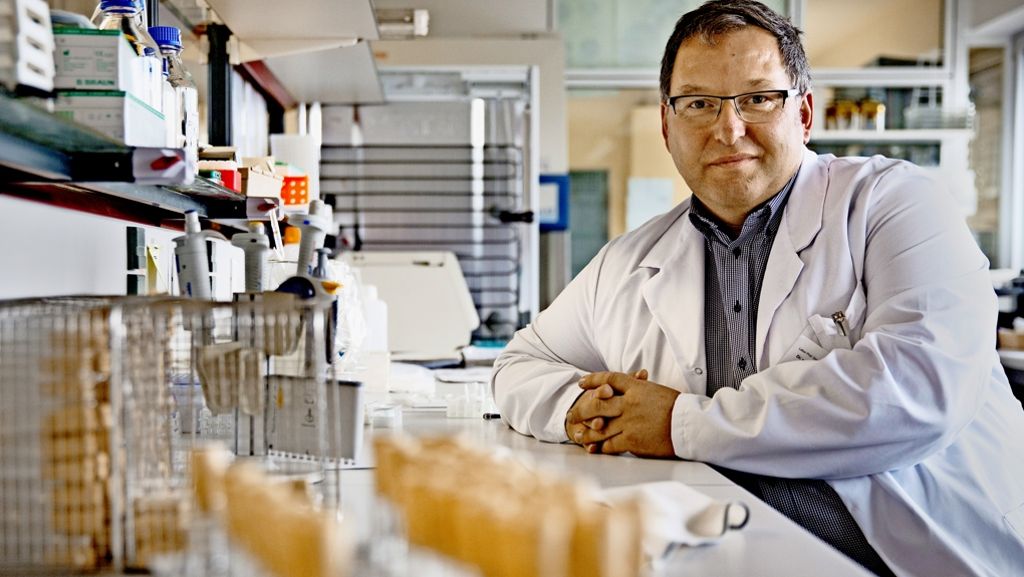Der Fellbacher Dr. Friedemann Tewald arbeitet als Labormediziner. Sein Job ist es, Krankheitserreger zu finden, die selbst für ein normales Mikroskop zu klein sind.
Fellbach/Stuttgart - Das bedrohliche schwarz-gelbe Piktogramm für „Biogefährdung“ hängt an der Glastüre. „Virusanzucht“, steht auf einem Schild darunter. Wir sind im Labor Enders, dem Arbeitsplatz von Dr. med. Friedemann Tewald. Hier, in dem Institut an der Stuttgarter Rosenbergstraße, sind der Fellbacher Tewald, elf weitere Ärzte und 300 weitere Mitarbeiter täglich auf der Suche nach Krankheitserregern, die oft so klein sind, dass sie mit einem normalen Mikroskop nicht zu entdecken sind. „Die Anzucht war lange die einzige Möglichkeit, einen Virus nachzuweisen“, erklärt Tewald. Eine Probe, etwa ein Speichelabstrich, wird dabei mit Zellkulturen in Kontakt gebracht. „Wir sehen dann nicht das Virus selbst, wohl aber das, was es mit den Zellen macht“, sagt Tewald.
Einer der Schwerpunkte des Labors Enders, in dem Tewald arbeitet, sind Infektionen in der Schwangerschaft. „Seit Ende Februar können wir auch auf das Zika-Virus testen“, sagt Tewald. Pro Woche werden etwa zehn Menschen, meistens werdende Mütter, die im vergangenen Jahr Südamerika bereisten, auf die Krankheit untersucht. In drei Fällen schlugen die Tests bisher an: Zika. „Zwei der Frauen waren schwanger, die Schwangerschaften sind aber gut verlaufen“, beruhigt der Mediziner. Die Neugeborenen seien nicht von Mikrozephalie, also einem zu klein geratenen Schädel, betroffen gewesen. „In Deutschland ist mir davon auch gar kein Fall bekannt“, sagt Tewald. Eine Zeit lang war es sogar fraglich, ob das vor allem Südamerika auftretende Zika-Virus überhaupt für das Phänomen der kleinen Köpfe verantwortlich ist. „Inzwischen ist das aber zweifelsfrei belegt.“ Er rechnet damit, dass er und seine Kollegen nach den olympischen Spielen in Rio de Janeiro häufiger auf das Virus testen müssen. „Dass sich Menschen in Deutschland mit Zika anstecken, halte ich aber für unwahrscheinlich“, sagt Tewald.
Der 51-jährige Fellbacher hat noch ein weiteres Fachgebiet. Auf Tewalds Schreibtisch liegt eine Ausgabe der Stuttgarter Zeitung, aufgeschlagen ist eine Themenseite über Zecken, Borreliose und FSME. In der Bildunterschrift wird eine Zecke auf dem Foto als Holzbock bezeichnet. „Es ist aber eine Buntzecke, und zwar ein adultes männliches Exemplar“, weiß Tewald. Die kleinen Blutsauger und die von ihnen übertragenen Krankheiten nennt er sein „Steckenpferd“. Patienten und Hausärzte schicken ihm und seinen Kollegen die abgelesenen Blutsauger zu, damit diese feststellen, ob die Tiere mit Borreliose oder FSME infiziert waren. Der Nutzen eines solchen Tests ist jedoch fraglich: „Diese Untersuchung hilft lediglich, Risiken abzuschätzen“, räumt der Arzt ein. „Nur 15 bis 20 Prozent der Stiche infizierter Zecken führen beim Menschen zu Borreliose.“
Insgesamt käme es nur bei etwa zwei von hundert Stichen zu einer Borreliose-Infektion; das Risiko, sich die Krankheit einzufangen, steige mit der Dauer, für die ein Tier sich festgesaugt hatte. „Unter zwölf Stunden ist eine Infektion sehr unwahrscheinlich“, beruhigt Tewald. Früher rieten Ärzte bei einem Zeckenstich zu einer vorsorglichen Behandlung mit Antibiotika. Davon rät Tewald ab: „Das kann zu Resistenzen führen.“ Inzwischen würden Antibiotika daher gezielter und vorsichtiger eingesetzt.